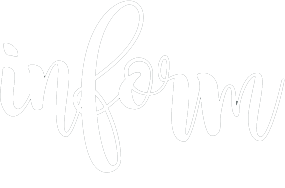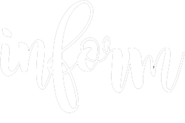Was ist die Gefahrstoffverordnung – und warum wurde sie jetzt überarbeitet?
Dr. Michael Born: Die Gefahrstoffverordnung ist ein zentrales Regelwerk, wenn es um den Umgang mit gefährlichen Stoffen am Arbeitsplatz geht. Sie soll Beschäftigte und Umwelt schützen. Die neue Gefahrstoffverordnung bringt keine Revolution, aber mehr Klarheit und Verbindlichkeit. Das gilt gerade für den Umgang mit besonders gefährlichen Stoffen, wie Asbest und CMR-Stoffen. Verantwortliche sollten jetzt genau hinsehen und vorbeugen – damit Risiken gar nicht erst entstehen.
Alexandra Schlenker: Bei den CMR-Stoffen handelt es sich um besonders gesundheitsgefährdende Substanzen, die oft lange Zeit unbemerkt Schäden im Körper verursachen und manchmal erst Jahrzehnte später zu ernsten Erkrankungen führen können. CMR steht für Stoffe, die krebserzeugend (“carcinogenic”), erbgutverändernd (“mutagenic”) oder fortpflanzungsgefährdend (“reprotoxic”) sind.
Was bedeutet das konkret für Betriebe? Müssen sie jetzt etwas verändern?
Alexandra Schlenker: Vieles war bereits Pflicht. Neu ist, dass bestimmte Vorgaben jetzt noch klarer und verbindlicher sind – vor allem, wenn es um den Umgang mit besonders gefährlichen Stoffen wie Asbest oder CMR-Stoffe geht. Entscheidend ist: Unternehmen müssen Gefährdungsbeurteilungen fachkundig durchführen und daraus konkrete Maßnahmen ableiten.
Dr. Michael Born: Es geht darum, echte Risiken zu erkennen und gezielt zu handeln. Nur so lassen sich Gesundheitsgefahren für Beschäftigte wirksam verringern. Dafür gibt es das STOP-Prinzip: Zuerst versucht man, gefährliche Stoffe zu ersetzen (Substitution), dann kommen technische und organisatorische Schutzmaßnahmen. Erst wenn das nicht ausreicht, kommen persönliche Schutzausrüstungen (PSA), wie Chemikalien-Schutzhandschuhe, Schutzbrillen, Atemmasken oder Schutzanzüge, zum Einsatz.
Warum sind denn CMR-Stoffe so gefährlich?
Dr. Joern-Helge Bolle: Diese Stoffe sind heimtückisch: Sie können über lange Zeit im Körper wirken, ohne dass Sie etwas merken. Viele Erkrankungen treten erst Jahre oder Jahrzehnte später auf – zum Beispiel Krebs oder Unfruchtbarkeit. Deshalb reicht es nicht aus, sich allein auf medizinische Vorsorgeuntersuchungen zu verlassen. Der beste Schutz ist, den Kontakt zu solchen Stoffen möglichst ganz zu vermeiden oder zumindest auf ein Minimum zu reduzieren.
Asbest ist doch schon lange verboten, warum ist es trotzdem noch Thema?
Dr. Michael Born: 1993 hat der Gesetzgeber Asbest zwar verboten, aber es steckt noch in vielen älteren Gebäuden, zum Beispiel in Fliesenklebern, Putzen, Spachtelmassen oder Fensterkitten. Oft wusste man früher gar nicht, dass es dort enthalten ist. Heute gibt es laut der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) noch über sechs Millionen Gebäude in Deutschland, deren Baumaterial Asbest enthält.
Dr. Joern-Helge Bolle: Daher gibt es heute – und vermutlich auch mindestens die nächsten Jahrzehnte noch – jedes Jahr viele Verdachtsfälle auf asbestbedingte Erkrankungen. Und leider mehrere hundert Todesfälle. Das zeigt, wie wichtig es ist, mit dem Thema weiterhin sehr sorgfältig umzugehen.
Woran erkennt man, ob ein Gebäude noch Asbest enthält?
Alexandra Schlenker: Als Laie kann man das nicht einfach sehen. Ein erster Hinweis ist das Baujahr: Wurde ein Gebäude vor 1993 errichtet, besteht grundsätzlich ein Verdacht.
Dr. Michael Born: Wenn fehlende oder unklare Bauunterlagen die Einschätzung erschweren, helfen oft nur Proben durch Sachverständige. Ohne fachkundige Prüfung lässt sich kaum sicher sagen, ob ein Material Asbest enthält oder nicht. Unser Rat: Lassen Sie ein Gebäude professionell beurteilen, wenn Sie sich nicht sicher sind.
Was schreibt die neue Verordnung zum Thema Asbest konkret vor?
Alexandra Schlenker: Besonders relevant ist der neue § 5a der Verordnung. Er verpflichtet sogenannte „Veranlasser“ – also auch private Bauherren – dazu, vor Beginn von Arbeiten zu prüfen, ob im Gebäude Gefahrstoffe, wie Asbest, vorhanden sein könnten. Ziel ist der Schutz der Beschäftigten auf der Baustelle.
Was passiert, wenn die Grenzwerte für gefährliche Stoffe überschritten werden?
Dr. Joern-Helge Bolle: Dann ist das ein klares Warnsignal. Wir empfehlen, dass Unternehmen ihre Schutzmaßnahmen überprüfen und sie bei Bedarf anpassen. Werden Grenzwerte überschritten, zeigt das, dass bisherige Maßnahmen nicht ausreichend wirken. Aber auch im Bereich der Gefahrstoffmessungen ist ein fachkundiges Vorgehen erforderlich, da Sie bei einer fehlerhaften Planung, Durchführung und Bewertung ansonsten womöglich falsche Messergebnisse erhalten. So geraten mögliche Gesundheitsgefahren leicht aus dem Blick.
Braucht es jetzt mehr ärztliche Vorsorgeuntersuchungen?
Dr. Joern-Helge Bolle: Ja, aber mit Maß. Bei Stoffen wie Lösungsmitteln sind regelmäßige Untersuchungen sehr hilfreich. Bei CMR-Stoffen wie Asbest ist es dagegen schwierig: Die Erkrankungen entwickeln sich oft über viele Jahre und werden meist erst spät entdeckt, manchmal leider auch zu spät. Das ist frustrierend, aber zeigt zugleich auch deutlich, wo der Fokus liegen muss: auf der Vermeidung von Risiken, nicht allein auf der Früherkennung. Die einzige wirksame Vorsorge ist, den Kontakt mit gefährlichen Stoffen zu verhindern zum Beispiel über das STOP- Prinzip bei der Auswahl geeigneter Schutzmaßnahmen.